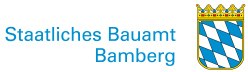Die Staatliche Dombauhütte Bamberg
Für den Staatlichen Hochbau ist der Unterhalt der Dome in Bayern eine wichtige kulturelle Aufgabe. Seit fast 100 Jahren erhalten die staatlichen Dombauhütten in Bamberg, Regensburg und Passau ihre mittelalterlichen Dome mit viel handwerklichem Geschick und fachlichem Wissen. Auf diese Weise lebt in ihnen die Tradition ihrer mittelalterlichen Vorbilder weiter.
Die Dombauhütten geben ihre Kompetenz und Tradition durch die Ausbildung junger Steinmetze auch an die nächste Generation weiter. Dadurch sind die historischen Zeugnisse des Glaubens und der Baukunst auch in Zukunft sichtbar. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der bayerischen Baukultur und der traditionsreichen Handwerkskunst.
Wie sehr dieses Fachwissen geschätzt wird, zeigt auch die Aufnahme des Bauhüttenwesens in das internationale Register Guter Praxisbeispiele durch die UNESCO.
Geschichte der Dombauhütten in Bayern
Die Dombauhütten sind Teil der zum Bayerischen Bauministerium gehörenden Staatlichen Bauämter in Regensburg, Passau und Bamberg. Sie sichern seit rund 100 Jahren mit kontinuierlichen Erhaltungs arbeiten, viel handwerklichem Geschick und detail liertem fachlichen Wissen den Bestand ihrer Dome.
Als Folge der Säkularisation hat der Bayerische Staat die Verpflichtung übernommen, kircheneigene Gebäude wie die Dome in Bamberg und Passau durch ständige Pflege zu erhalten.
Dombauhütte Bamberg
Die Geschichte Bambergs beginnt mit der Bistums gründung 1007 durch König und späteren Kaiser Heinrich II. sowie seine Frau Kunigunde. Der erste Dombau wird 1012 geweiht, mehrere Brände führen schließlich zu einem vollständigen Neubau.
Baubeginn war am Ende des 12. Jahrhunderts. Mit seinen zwei Chören hält sich der Neubau gestalterisch nahe am Vorgänger, wird jedoch in großzügigeren Dimensionen und mit vier statt nur zwei Türmen errichtet. Die Schluss weihe des zweiten Dombaus kann bereits 1237 erfolgen. Die hervorragend gearbeiteten Skulpturen an den Portalen und an den östlichen Chorschranken zeigen deutlich französischen Einfluss.
Die Bauhütte – das sogenannte Kunigundenwerkamt – findet erstmals im 15. Jahrhundert Erwähnung. Die Säkularisation führt zur Auflösung der kircheneigenen Bauhütte und das Land Bayern übernimmt den Bauunterhalt. Im Rahmen umfassender Restaurierungsarbeiten wird 1929 eine staatliche Dombauhütte eingerichtet.

Die zwei Westtürme mit ihrem reichen ornamentalen Schmuck und den durch Öffnungen aufgelösten Wand flächen sind die ersten Sanierungsobjekte der Dombauhütte. Nach dem 2. Weltkrieg folgt die Sanierung der beiden Osttürme. Im Jahr 1968 kehren die Arbeiten mit der erneuten Sanierung des Nordwestturmes an ihren Ausgangspunkt zurück. Ab 1988 ist auch der Südwestturm wieder in Arbeit. 1997 beginnt die restauratorische Sicherung des Fürstenportals und das Ersetzen der Gewändefiguren durch Kopien. Mit der Altarweihe im Jahr 1996 ist nach dreijähriger Bauzeit eine besondere Aufgabe der Dombauhütte abgeschlossen: Der Bau einer neuen Bischofsgrablege unter dem Westchor des Domes nach einem Entwurf des Architekten Freiherr Alexander von Branca. Seit 2011 wird
eine Sanierung der beiden Osttürme durchgeführt.

2018 erhält der Dom eine energetische Ertüchtigung der Beleuchtung. Wen die ursprünglich polychrom gefasste Figur des Bamberger Reiters am Pfeiler in Eingangsnähe darstellt, ist ebenso unklar wie der Name des Schöpfers und der ursprüngliche Aufstellort. Sicher ist jedoch, dass es sich um eine herausragende bildhauerische Leistung des frühen 13. Jahrhunderts handelt. Hergestellt aus Schilfsandstein gilt er – zusammen mit dem lachenden Engel – als das Wahrzeichen des Doms.


Die mittelalter lichen Dome in Bamberg, Regensbur und Passau sind herausragende Denkmäler der bayerischen Geschichte.